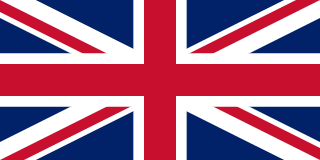Ressourcen
Wertvolle Ressourcen stehen für Dich bereit – inklusive NLP-Übungsgruppen, NLP-Bibliothek und NLP-Online-Community.
Lektionen
» Herzlich Willkommen
» Wahrnehmung (01)
» Innere Erlebniswelten (02)
» Kongruenz (03)
» Kalibrieren I (04)
» Kalibrieren II (05)
» Pacing I (06)
» Pacing II (07)
Audio/Videobeiträge
» Herzlich Willkommen
» Was heißt NLP?
» Äußere Wahrnehmung
» Kongruenz
» Kalibrieren
» Nutzen von Kalibrieren
» Gefühlsradar
» Kalibrierungsübung
» Pacing Beispiele
» Rapport
» VIDEO: Spiegeln
» Überkreuz Spiegeln
Textartikel
» Was ist NLP?
» Geschichte des NLP
» Vorstellung der Sinne
» NLP-Vorannahmen
» Sinnestäuschungen
» Wahrnehmungsfilter
» Der Prinz und der Magier
» Kongruenz u. Authentizität
» Klassische Körpersprache
» Mehr zu Körpersprache
» Gleich und Gleich
Erfolgskontrollen
Ursprung des Begriffs Pacing
Der Begriff Pacing kommt vom englischen Wort „pace“ – Schritthalten – und wurde ursprünglich in der Pferdedressur verwendet. Auch in der Leichtathletik kennt man den Begriff „Pacer“. Das sind die Tempomacher, die in den ersten Runden vorneweg laufen und ein schnelles Tempo vorgeben, ehe sie dann aussteigen. Verliert das Feld jedoch den Anschluss, also wenn sie zu schnell laufen, haben sie ihre Aufgabe nicht erfüllt. Behalte das im Hinterkopf, wenn wir in der nächsten Lektion zum Thema Leading kommen.
Du weißt bereits, dass Pacing im NLP eine über kürzere oder längere Zeit aufrechterhaltene, möglichst unauffällige Nachahmung verbaler und/oder nonverbaler Verhaltensweisen des Gegenübers meint. Diese führt – häufig sehr rasch, manchmal erst nach einer Weile – dazu, dass sich der Gesprächspartner angenommen und verstanden fühlt. Das basiert nicht auf einer Illusion, vielmehr kann derjenige, der das Pacing anwendet, den anderen tatsächlich besser verstehen, da er durch das Angleichen sowohl kognitiv als auch emotional viel über ihn erfährt – er wird ihm also ein Stück weit ähnlich.
Gutes Spiegeln führt zu einem vertieften Rapport und erzeugt eine besondere Form von Sympathie. Spiegeln darf jedoch nicht als Nachäffen missverstanden werden. Ebenso sollte man keine körperlichen Leiden oder Nervosität spiegeln. Pacing wirkt nur, wenn man dabei kongruent bleibt – sonst wirkt man unnatürlich. Möchte man den Rapport bewusst beenden, kann gezieltes Nicht-Pacen (sogenanntes Miss-Matching) helfen.
Eine besondere Form des Pacings – das Überkreuz-Pacing
Überkreuz-Pacing bedeutet, dass du nonverbale Signale deines Gesprächspartners nicht mit denselben, sondern mit anderen Körpersignalen spiegelst. Wichtig ist dabei der gemeinsame Rhythmus. Du kannst den anderen auch in einem anderen Repräsentationssystem spiegeln.
Beispiele für Überkreuz-Spiegeln
Du kannst beispielsweise mit dem Auf und Ab deiner Handbewegung das Auf und Ab der Brustkorbbewegung deines Gesprächspartners beim Atmen spiegeln. „Überkreuz“-Spiegeln funktioniert auch, wenn du den Atem oder eine Bewegung mit einem anderen Körperteil aufnimmst – etwa wenn du jedes Mal, wenn sich dein Gegenüber am Kinn kratzt, leicht den Daumen bewegst. Oder du spiegelst den Tonfall des Gesprächs mit kleinen Bewegungen deiner Fußspitze.
Ebenso kannst du üben, den Atemrhythmus einer Person über deinen eigenen Sprechrhythmus zu spiegeln. Der Sprechrhythmus dieser Person kann wiederum durch eine feine Bewegung deiner Hand begleitet werden.
Eine solche Methode empfiehlt sich besonders bei einem beginnenden Asthma-Anfall: Der Betroffene atmet immer schneller. Würdest du ihn direkt spiegeln, würdest du selbst zu hyperventilieren beginnen. Deshalb spiegle den Atemrhythmus in einem anderen System – wie oben beschrieben.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Beim direkten Pacing wird durch tatsächliches Angleichen gespiegelt, beim indirekten Spiegeln nutzt man analoge Ausdrucksformen in anderen Kanälen.