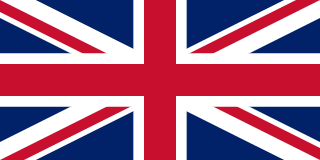Ressourcen
Wertvolle Ressourcen stehen für Dich bereit – inklusive NLP-Übungsgruppen und NLP-Bibliothek.
Lektionen
Audio/Videobeiträge
Erfolgskontrollen
» Testing 01
» Testing 02
Abbildung der Augenzugangshinweise
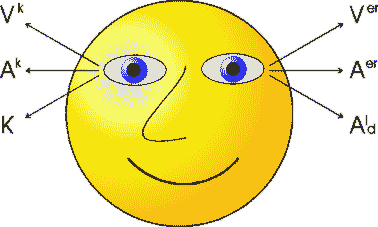
Fakten zu Augenzugangshinweisen
Die Wissenschaft wird häufig an der Praxistauglichkeit ihrer Ergebnisse gemessen. Um den Augenzugangshinweisen in dieser Richtung eine gewisse Relevanz zu verleihen, hier einige Hintergründe aus der Forschung.
Das Modell der Augenzugangshinweise beansprucht keine allgemeine Gültigkeit. Wie bereits erwähnt, kann es bei Linkshändern durchaus seitenverkehrt sein, und eventuell ist es im Einzelfall nicht zutreffend.
Wichtiger jedoch als die mechanische Anwendung des NLP-„Augen“-Modells ist der Grundgedanke, der hinter diesem Modell steht: auf Augenbewegungen bei anderen Menschen sorgsam zu achten und ihnen für innere Prozesse eine systematische Bedeutung zu geben.
Für die Dichter sind die Augen die Fenster zur Seele. Für eine Gruppe von modernen Neuropsychologen scheinen sie entsprechend als Fenster zur linken und rechten Hirnhälfte. Im Rahmen seiner klinischen Untersuchungen (1964) bemerkte der Psychologe M. E. Day, dass bestimmte Patienten bei der Beantwortung von Fragen besonders oft nach rechts und andere wiederum besonders oft nach links blickten. Auf der Grundlage dieser und weiterer Forschungen nahm Day an, dass die Richtung dieser bevorzugten seitlichen oder lateralen Augenbewegungen (LEMs – von englisch lateral eye movements) mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen einer Person zusammenhängen.
Fünf Jahre nach M. E. Day veröffentlichte der Psychologe Paul Bakan von der Simon-Fraser-Universität in Kanada Daten, die Days Überlegungen bestätigten. Darüber hinaus stellte Bakan fest, dass die bevorzugte Augenbewegung auch mit der Hemisphärenasymmetrie zusammenhängt. Bakans Hypothese begründet sich auf der gut erforschten Tatsache, dass die seitlichen Augenbewegungen von Zentren im Frontallappen der jeweils contralateralen Hirnhemisphäre kontrolliert werden. Er vermutete, dass kognitive Aktivitäten, die vorrangig in nur einer der beiden Hirnhälften ablaufen, Augenbewegungen in die entgegengesetzte Richtung auslösen und dass man diese Bewegungen daher auch als Anzeichen der relativen Aktivität der Hemisphären einer Person ansehen kann (das heißt: blickt eine Person bei einem bestimmten Denkprozess vermehrt nach links, so ist das ein Hinweis darauf, dass sie bei diesem Denkprozess die rechte Hirnhälfte besonders stark benutzt).
Dementsprechend sind Menschen, die oft bzw. in den meisten Situationen links blicken, Personen, bei denen die rechte Gehirnhälfte dominiert. Bei rechts blickenden Menschen deutet dies auf die bevorzugte Benutzung der linken Hirnhälfte hin. Bakan betrachtete die Richtung der bevorzugten Augenbewegung als eine typische Eigenschaft einer Persönlichkeit.
Gary Schwarz und seine Mitarbeiter von der Yale-Universität (1975) haben die lateralen Augenbewegungen bei der Beantwortung von Fragen zu Gefühlen untersucht. Es wurden u. a. sprachlich-emotionale Fragen („Welche Emotion ist für Sie stärker?“) und solche mit bildlich-emotionaler Vorstellung („Wenn Sie sich das Gesicht Ihres Vaters vorstellen, welche Gefühle empfinden Sie?“) benutzt. Das Ergebnis zeigte – in Übereinstimmung mit früheren Befunden –, dass emotionale Fragen mehr LEMs (Augenbewegungen) nach links auslösten. Die Tatsache, dass sich bei emotionalen Aktivitäten eine stärkere Rechtshirnausprägung zeigt, konnte auch hier festgestellt werden. Im emotionalen Bereich zeigte sich, dass Personen, die krebskrank oder chronisch krank waren, in den meisten Fällen eine vermehrt aktive rechte Hirnhälfte aufwiesen. Links-Rechts-Augenbewegungen halfen, die Hirnhälften willentlich auszugleichen, was gleichbedeutend war mit einem verbesserten mentalen, emotionalen und körperlichen Zustand.
Anwendungsmöglichkeiten
Bei intensiver Forschung sind die Augenzugangshinweise durchaus von großem praktischem Nutzen. Zunächst können die Augenbewegungen als äußerer Indikator zur Erforschung der menschlichen Hirntätigkeit beitragen. Deutlichere wissenschaftliche Ergebnisse auf diesem Gebiet würden vor allem helfen, unser Denken besser zu strukturieren und zielgerichteter einzusetzen. Ausgehend von genialen „Musterbeispielen“ und der Analyse ihrer Denkmuster könnten Konzepte zum zielgerichteten Einsetzen der Repräsentationssysteme entwickelt werden.
Dieses System könnte ein alltäglicher Bestandteil im Schulalltag sein. Augenzugangshinweise könnten auf die Denkmuster der Schüler hinweisen. Schülern mit Lernschwierigkeiten könnte man so konkret aufzeigen, wo sie einen unangebrachten Denkansatz verwenden. Außerdem könnte man auf diese Weise eine individuelle Lernstrategie konstruieren. Derartige Ansätze werden in der aktuellen Gestaltung der Lehrpläne so gut wie gar nicht berücksichtigt. Konzepte dieser Art würden nicht nur Schülern helfen, sondern ließen sich auf alle gesellschaftlichen Gruppen vom Manager bis zum Fließbandarbeiter übertragen.
Man kann durch die Augenbewegungen erkennen, wie ein Mensch wahrnimmt. Durch die Analyse individueller Wahrnehmungsmuster kann man seine Wahrnehmung effizienter und zielgerichteter einsetzen. Wenn es beispielsweise ein Musiker schafft, während des Musizierens fast ausschließlich auditiv wahrzunehmen, lassen sich seine Leistungen erheblich verbessern.
Augenzugangshinweise können da ansetzen, wo andere Möglichkeiten der Analyse versagen. So kann man durch Augenzugangshinweise mehr vom Denken und Fühlen schwerstbehinderter Menschen erfahren. Bei der klassischen Psychotherapie können sie dazu beitragen, Krankheitsbilder zu behandeln. Denkbar wäre auch eine Anwendung in der Sexualtherapie, um zu erkennen, ob Störungen durch eine Beeinträchtigung des Wahrnehmungsbildes entstanden sind.
Einige Juristen kamen auf die Idee, die Augenbewegungen in der Kriminologie anzuwenden und Täter anhand ihrer Augenbewegungen zu entlarven oder zumindest zu überprüfen, ob sie sich gerade erinnern oder einen Sachverhalt frei erfinden. Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber als Anhaltspunkt könnte diese Unterscheidung interessant sein.
Wir haben hier eine Fülle möglicher Anwendungsfelder für Augenzugangshinweise aufgezeigt. Das suggeriert eventuell, dass dies von heute auf morgen ohne große Anstrengungen möglich sei. Um einer Realisation nahe zu kommen, wäre eine engagiertere und aufwendigere Forschungsarbeit wünschenswert.
Exkurs: Gegenargumente gegen die Augenzugangshinweise
Auszug aus dem „Practitioner-Handbuch“ (= gelbe Seiten) von Klaus Grochowiak
Es gab einige Studien von Psychologen, die untersuchen sollten, ob es tatsächlich AZH gibt oder nicht. Einige dieser Studien kamen zu dem Ergebnis, dass es so etwas wie AZH gar nicht gibt. Diese Studien enthielten jedoch systematische Untersuchungsfehler und sind insofern für unsere Arbeit nicht weiter wichtig, da sie Dinge widerlegt haben, die so gar nicht behauptet worden sind. Im Folgenden werden die Details der Theorie über AZH erläutert, die wichtig sind, um kompetent damit umzugehen – einschließlich der häufigsten Gegenargumente.
- 1. Das Lead-System ist ein anderes als das Repräsentationssystem, nach dem gefragt wurde. Viele Menschen können sich z. B. eine auditiv-erinnerte Information nicht direkt zugänglich machen, sondern benötigen zuerst ein inneres Bild, bevor sie die zugehörige Stimme erinnern können (Folge: Vk → Ae).
- 2. Eine Person kann auf eine Frage nach Ae mit einer Synästhesie Vk → Ae reagieren, sodass nur der visuelle Zugang erkennbar ist. Die Theorie behauptet nicht, dass man allein durch die AZH immer das innere Repräsentationssystem erkennt.
- 3. Wenn jemand nach einer visuellen Erinnerung gefragt wird, kann er in den visuell-konstruierten Bereich gehen. Das bedeutet nicht, dass die Person lügt; es kann sich um eine dissoziierte oder eine Gestalt-Erinnerung handeln.
- 4. Einige Menschen defokussieren, wenn sie visuell erinnern oder konstruieren. Dabei stellen sie die Augen auf „unendlich“, um äußere Reize zu reduzieren und innere Bilder besser wahrzunehmen – z. B. beim Tagträumen.
- 5. In manchen Untersuchungen wurde nicht klar zwischen nach außen gerichteten und inneren Augenbewegungen unterschieden.
- 6. Viele Menschen gehen unabhängig von der Frage immer zuerst in dasselbe Repräsentationssystem, etwa auditiv-digital oder visuell-konstruiert. Das ist häufig eine individuelle Denkgewohnheit.
Diese Punkte zeigen: Das Modell der Augenzugangshinweise ist kein starres Schema, sondern ein Werkzeug, um individuelle Wahrnehmungs- und Denkmuster besser zu verstehen.